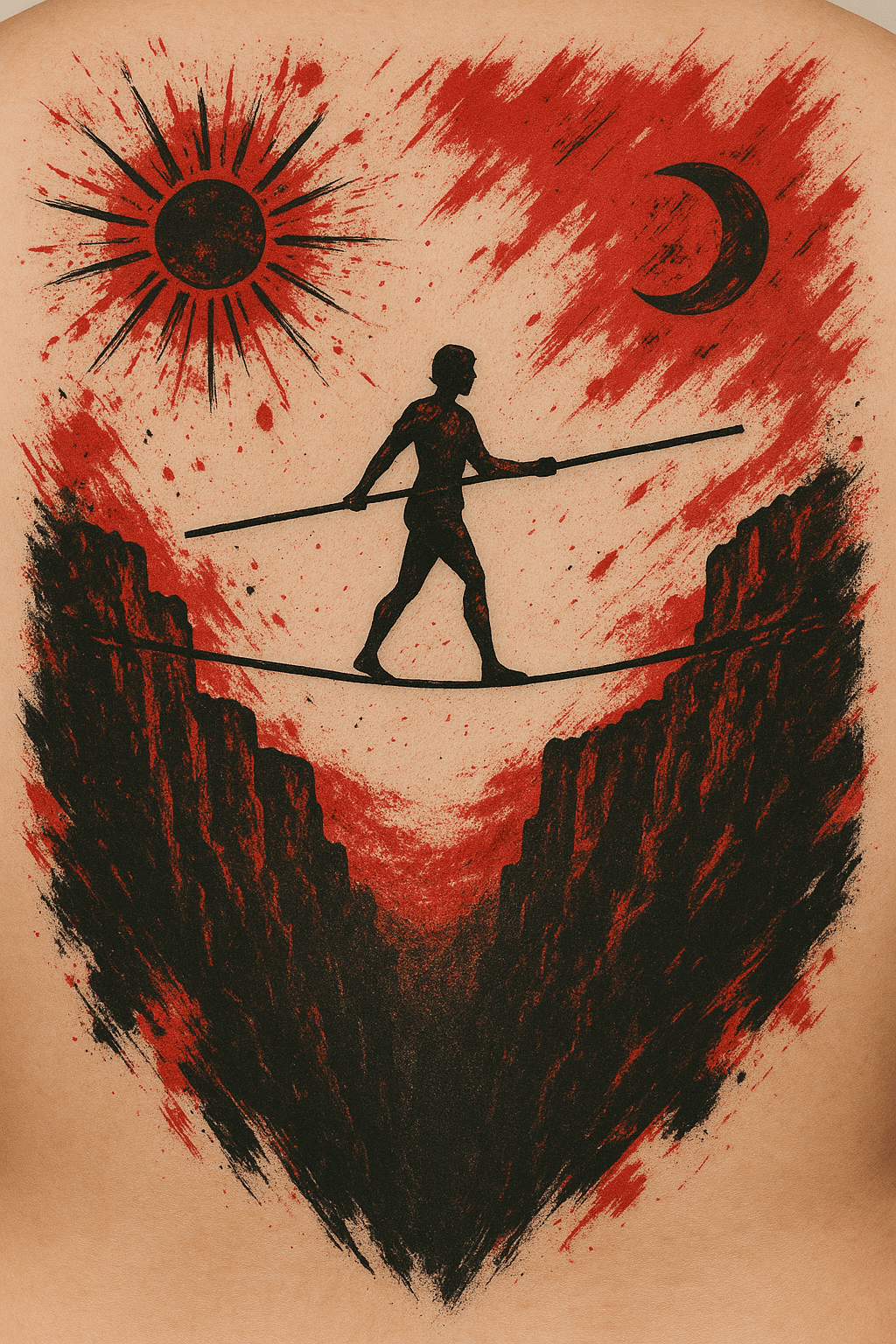Brief meiner Mutter als Reaktion auf „Muttersturm“, Mai 2005
Hallo Lou,
Warum hast du mir dein Buch geschickt? Was willst du damit erreichen? Und was erwartest du von mir? Du wirst meine Meinung dazu lesen, aber sie wird deinen Erwartungen wohl kaum entsprechen. Und deine Drohung, „es zu ignorieren wäre ungesund“, soll mich das beeindrucken? Ich finde diese Drohung sehr kindisch, und sie beeindruckt mich nicht im Geringsten. Ich könnte dein Buch ignorieren, ich wollte es auch erst tun, aber dann habe ich mich entschlossen, es nicht zu tun, denn es gibt einiges klarzustellen und das werde ich jetzt mal tun:
Du hast den falschen Titel gewählt; das Buch sollte den Titel „Die Abrechnung“ tragen, denn nichts anderes ist es doch, oder?
Fangen wir mit der kleinen Fotogeschichte an: ich war zuerst im Fotostudio und danach haben wir die anderen Fotos gemacht und DU hattest auch deinen Spaß daran; von wegen Ekel und Abscheu, du hast vergessen zu erwähnen (?), dass ich von dir auch sollte Fotos machen sollte, wir hatten nur keinen Film mehr an diesem Tag und später hat es sich nicht mehr ergeben. Und ja, verdammt, ich war 41 und mit meinem Körper durchaus zufrieden und ich bin es heute auch noch und würde noch mal ins Fotostudio gehen, denn es hat mir verdammt viel Spaß gemacht. Was ist dabei, wenn man mit seinem Körper zufrieden ist? Nur weil DU bis heute offensichtlich nicht weißt, ob du Männlein oder Weiblein sein sollst und deswegen mit deinem eigenen Körper nicht zurecht kommst, müssen sich andere ja nicht verstecken.
Zum Thema Mutter: Niemand kann wissen, wie es ist, Mutter zu sein, bevor man es nicht wirklich ist. Deine Meinung, wie eine Mutter zu sein hat, ist sehr überheblich. Eine Mutter (wie auch ein Vater) ist nur ein Mensch und keine vorprogrammierte Maschine. Ein Mensch macht Fehler, das liegt in seiner Natur, niemand kann immer alles richtig machen, eine Mutter auch nicht und auch kein Vater. Deine Analyse von mir ist …..da fällt mir kein passendes Wort ein, aber ich bin echt erstaunt, dass andere Menschen (ich weiß nicht, wen du da gefragt hast) so genau wissen, warum ich Kinder bekommen habe. Wer maßt sich an, das zu wissen? Das erste Kind, Marco, habe ich bekommen, weil ich mir sehnlichst ein Kind gewünscht habe, ganz natürlich für jede gesunde Frau. Das zweite Kind, dich, habe ich bekommen, weil es eben passiert ist und du wurdest geboren, weil ich es so wollte, denn wäre es nur nach deinem Vater gegangen, wärst du nicht auf dieser Welt. Seiner damaligen Meinung nach war der Zeitpunkt für ein zweites Kind sehr ungünstig. Mit dem dritten Kind, Isabell, wollte ich versuchen, unsere Ehe zu retten, was falsch war, denn mit einem Kind kann man keine Ehe retten, aber ich habe das nie bereut und ich bin froh, dass Isabell damals überlebt hat.
Zum Thema Vater: Dein Vater ist ja dein Superdaddy, immer für euch da, hat sich immer um euch gekümmert und ich, die unfähige überforderte Mutter hat ihn mit ihrer Eifersucht und Aggressivität nur genervt. Natürlich war ich eifersüchtig und deshalb auch aggressiv, schließlich hat er mich betrogen, sollte ich darauf gleichgültig reagieren? Ich hab deinen Superdaddy bei der Scheidung keineswegs über den Tisch gezogen; ich habe nichts beansprucht, was mir nicht zugestanden hätte. Die Möbel hat er mir doch großspurig freiwillig überlassen, weil er wusste, dass ich sie so oder so kriegen würde, denn so läuft das bei einer Scheidung. Der Elternteil, der das Sorgerecht hat und bei dem die Kinder wohnen, bekommt die Einrichtung. Er musste auch nicht alleine für unsere Schulden aufkommen, denn die wurden gegen gerechnet, dafür habe ich keinen Ehegattenunterhalt bekommen, der mir normalerweise zugestanden hätte und der Unterhalt für Kinder ist gesetzlich festgelegt, ich konnte ihn also gar nicht über den Tisch ziehen, selbst wenn ich gewollt hätte. Das alleinige Sorgerecht für euch habe ich auf Anraten meines Anwaltes beantragt, denn dein Superdaddy hat entweder nur dich oder Marco gelegentlich mal abgeholt. Einer von euch beiden saß dann immer heulend am Fenster und ich hatte das Theater Zuhause. Wirklich beruhigen konnte ich euch nie, ein Akt seelischer Grausamkeit deines Superdaddys. Sich alle zwei Wochen regelmäßig um alle seine drei Kinder zu kümmern, war ihm nämlich lästig, ER war mit euch überfordert, nicht ich. Er hat dir offensichtlich was anderes erzählt. Hat dein Superdaddy da ein bisschen gelogen? Um mir dieses ständige Theater und euch die psychische Belastung zu ersparen, hab ich ihm damals ein Ultimatum gestellt: entweder er nimmt euch regelmäßig alle drei, oder er kann bleiben wo der Pfeffer wächst. Er hat den Pfeffer vorgezogen, über zehn Jahre lang. Es war seine Entscheidung, nicht meine. Hat er dich nicht rausgeschmissen, weil er mit dir auch nicht zurechtkam und du seine geliebte Wohnung verwüstet hast, als er im Urlaub war? Dass ich dich als Baby lieblos behandelt habe, ist auch gelogen. Frag deinen Superdaddy doch mal, was er gemacht hat, wenn einer von euch nachts mal geweint hat wegen irgendwas oder wenn ihr krank gewesen seid!! Geschlafen hat er, angeschissen hat er mich, ich sollte dafür sorgen, dass ihr ruhig seid, weil er ja schlafen musste. Schlafen darf übrigens nur ein Vater, eine Mutter darf nachts nicht schlafen, sie hat 24 Stunden für die Kinder da zu sein!!!
Das Tochterbild: Dazu gibt es nicht viel zu sagen, hier trieft das Selbstmitleid aus jedem Wort. Dass du nicht in den Kindergarten gehen konntest, habe ich damals auch bedauert, ich hätte gerne mal ein paar Stunden ohne dich gehabt, aber ich habe keinen Platz bekommen und Isabell kam nur in den Genuss, wie du es nennst, weil das Sozialamt mir geholfen hat, einen Platz für sie zu bekommen, damit ich wieder arbeiten gehen konnte.
Das Thema Zahnspange: Es war deine eigene Entscheidung, keine zu tragen. Erinnere dich bitte daran, was für ein Theater du schon beim Kieferabdruck gemacht hast. Du hast Rotz und Wasser geheult. Ich hab deine Hand gehalten, du hast sie mir fast zerquetscht und als der Zahnarzt sagte, dir müssten die hinteren vier Backenzähne gezogen werden, weil die anderen Zähne Platz bräuchten, da wolltest DU keine Zahnspange mehr. Heute trägst DU die Konsequenzen dafür, aber natürlich habe ich Schuld. Eine Mutter hat immer Schuld! Als Isabell in den Konfirmandenunterricht ging, hast du einen Affenaufstand gemacht, weil sie durfte und du nicht, aber nicht in den Konfirmandenunterricht zu gehen, war damals auch DEINE Entscheidung.
Kommen wir nun zu dem Thema Misshandlung: Es stimmt, du hast öfter mal was auf den Hintern oder eine Ohrfeige gekriegt, manchmal warst du eben nur so zu bändigen, denn du warst wirklich wild und hast oft rumgetobt. Das haben deine Geschwister auch, aber sie haben meistens sofort aufgehört, wenn ich es euch gesagt habe, du nicht, du musstest immer und immer weitermachen. Selbst als ich dir androhte, dich zu verhauen, wenn du nicht aufhörst, hast du weitergemacht und du warst damals alt genug, um zu verstehen, worum es ging. Da sind wir wieder beim Thema Konsequenzen! So bist du auch zu der Narbe an deiner Augenbraue gekommen. Du wolltest wieder mal nicht hören. Ich erinnere mich genau: Ich hab dich noch angeschrien, du sollst nicht mit Socken auf dem glatten Fußboden so rumrennen, du solltest deine Pantoffeln anziehen. Nein, du musstest weiter um den Küchentisch rennen, dann bist du plötzlich ausgerutscht und gegen das Tischbein geknallt. Du hast geblutet wie Sau! Ich hab mich so erschrocken, das werde ich nie vergessen. Gott sei Dank sah alles schlimmer aus, als es war.
Was du auf den Seiten 21 – 61 schreibst, entspricht ebenfalls nur zu einem kleinen Teil der Wahrheit.
Hätte ich dir jemals derartige Misshandlungen zugefügt, wärst du heute nicht mehr unter uns. Solche Misshandlungen verursachen innere Verletzungen, die allerschlimmsten bei einem so zierlichen Kind, wie du es warst und sie hinterlassen innere Narben an Knochen und Organen. Lass dich doch mal eingehend untersuchen, bei dir wird man keine Narben finden. Eingesperrt habe ich dich oft und auch ignoriert, wenn du mal wieder Scheiße gebaut hast, und das war verdammt oft. Bei dir hatte ich immer das Gefühl, dass du mich absichtlich provozieren willst, mit falsch weggeräumtem Geschirr, mit Sachen, die du angeblich vergessen hast zu putzen und mit vielen anderen Dingen, die du getan hast.
Jeder von euch hatte sein eigenes Zimmer, deins war dein Heiligtum, da durfte niemand ungefragt rein, jedes Mal ein Affenaufstand, wenn Marco oder Isabell mal drin waren, um sich Sachen wiederzuholen, die du dir ausgeliehen und nicht zurückgegeben hattest, aber DU hattest keine Hemmungen, jederzeit ohne Grund in ihre Zimmer zu gehen, um dir irgendetwas zu nehmen, das war normal. Dir konnte ich einfach nicht vertrauen, deshalb habe ich dich immer eingeschlossen, wenn Jörg und ich weggingen. Du hast immer in unseren Sachen geschnüffelt und dir genommen, was dir grad so in die Finger kam. Deine Schilderungen dieser Geschehnisse sind ein wenig verdreht, so wie es dir am besten passt. Mir kam beim Lesen dieser 40 Seiten der Gedanke, dass du gerne dieses arme psychisch und physisch misshandelte Kind sein willst, um dein Verhalten von damals und der jüngsten Vergangenheit zu rechtfertigen. Deine kleine Geldgeschichte finde ich auch sehr interessant, denn sie ist total verdreht. Als du und ich damals Jörgs Sachen gepackt haben, hattest du riesigen Spaß daran – du hast mir gesagt, wie sehr du ihn hasst (das hättest du mir viel eher mal sagen können) und du hast mir mit voller Genugtuung gestanden, dass du ihm damals tatsächlich die 500 DM geklaut hast; du hattest sie im kleinen Wäldchen vergraben und nach und nach für Süßigkeiten, Zeitungen und andere Kleinigkeiten ausgegeben. Wieso erzählst du heute eine ganz andere Geschichte? Und die Sache mit dem Stock; glaubst du tatsächlich, ich hätte zugelassen, dass er dich damit verprügelt? Ich habe keinen Grund ihn in Schutz zu nehmen; er ist ein versoffenes Arschloch und hat mir lange genug viel seelisches Leid zugefügt, bis ich es endlich geschafft habe, ihn rauszuschmeissen. Er hat dich nicht verprügelt!
Schatten des Egoismus: Richtig ist, dass ich von dir schriftlich haben wollte, was alles zwischen dir und Steven abgelaufen ist, weil ich wegen Isabell Beweise gegen ihn brauchte. Falsch ist allerdings, dass ich wollte, dass DU Nebenklage einreichst. Erinnere Dich, dass wir damals in einem Telefongespräch darüber gesprochen haben, was zu tun ist.. Ich habe keineswegs verlangt, dass du Nebenklage einreichst, ich habe dir gesagt, dass du das selbst entscheiden musst, aber dass du von mir jede Unterstützung bekommst, falls du dich dafür entscheidest. Du hast dich aber dagegen entschieden.
Willst du wissen, was in mir vorging, als ich deinen Brief gelesen habe? Ich hab geheult, aus Mitleid für dich, aus Wut über Steven und am meisten, weil ich es nicht verhindert habe, aber wie konnte ich etwas verhindern, von dem ich nichts gewusst habe. Warum hast du mir damals bloß nichts davon erzählt? Hast du gedacht, ich glaube dir nicht? Ja, hast du, denn ich war ja die böse Mutter, die dir sowieso nicht glauben würde und außerdem noch in dieses Arschloch verliebt. Verdammt, Lou, DAS hätte ich dir geglaubt, weil ich nämlich NICHT auf den Gedanken gekommen wäre, du hättest dir DAS ausgedacht!!! Dass wir später keinen Kontakt mehr hatten, lag nicht nur an mir, denn den letzten Termin, den wir ausgemacht hatten, hast DU abgesagt. Ich hätte mich damals gerne mit dir ausgesprochen, aber du hast Recht, das Gespräch wäre nicht so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast, aber nur, weil deine Erwartungen zu hoch sind. Du erwartest, dass ich vor dir krieche, dich um Verzeihung bitte für alles, was ich dir angeblich angetan habe, aber was ist mit MIR? Mit allem, was DU mir angetan hast? Du hasst mich, weil ich dir nicht die Mutter war oder bin, die du dir wünscht, aber eine Mutter, die deinen Vorstellungen entspricht, gibt es auf der ganzen Welt nicht. Du bist auch nicht gerade die Tochter, die man als Mutter gerne hätte, deswegen hasse ich dich aber nicht. Du bist eben so, wahrscheinlich sind es die Gene aus der Familie deines Superdaddys, da haben ja so einige einen Schuss!
Kommen wir zu den Seiten 72 bis Ende:
Conny: Sie hat dich bei sich aufgenommen; hast du jemals DANKE dafür gesagt? Und wie kam es noch dazu, dass du dann doch zu Supperdaddy ziehen musstest? Nicht, weil die beiden sich getrennt hatten!
Autoagressionen/Borderline-Syndrom: Was ist das für ein Psychoquatsch? Muss man sich als Mutter damit auch auskennen? Leide ich vielleicht auch darunter, weil MEINE Mutter mich auch manchmal nicht verstanden und mir ab und zu auch mal eine Ohrfeige verpasst hat?
Der Auszug: Weißt du eigentlich, wie froh ich war, als du weg warst? Ich hätte dich niemals rausgeschmissen, weil ich immer gedacht hab, es gibt irgendeinen Weg, mit dir auszukommen, mich mit dir bzw. dich zu verstehen, aber mit deinem Auszug hast du MIR jede Entscheidung abgenommen. Dafür ein DANKE. Die Ruhe, die darauf folgte, tat einfach nur gut. Keine Leere, keine Wut, nichts, außer Ruhe. Diese Entscheidung war für uns alle die beste. Allerdings entsprechen die Geschehnisse kurz vor deinem Auszug auch nicht ganz der Wahrheit, einiges hat sich ein bisschen anders zugetragen, aber darauf gehe ich jetzt nicht mehr ein, denn nach so vielen Seiten habe ich begriffen, dass deine Wahrheit und meine Wahrheit zwei völlig verschiedene sind.
Den Satz auf Seite 93 „du hast verloren, du hast verloren“ möchte ich so kommentieren: Ich hatte nie das Gefühl, etwas verloren zu haben, im Gegenteil, durch deine Abwesenheit habe ich eine Menge gewonnen.
Epilog: Sei ehrlich, auch hier viel Selbstmitleid und das Thema „Mutter“ ist für dich nicht abgeschlossen, sonst hättest du deine Geschichte nicht in ein Buch gebunden und mir, deiner Mutter, zum Lesen geschickt. Du hast doch irgendwas von mir erwartet, also gibt es das Thema „Mutter“ noch. Du vermisst mich nicht, schreibst du. Tust du das wirklich nicht? Und ich vermiss dich nicht? Woher willst du das wissen? Du weißt nichts von mir oder meinen Gefühlen; damals hat es dich scheinbar nicht interessiert, tut es das heute vielleicht? Du bleibst immer meine Tochter, egal wo du bist und ich denke oft an dich, ob du es glaubst oder nicht.
Was also willst du von mir? Dass ich mich schuldig bekenne im Sinne deiner Anklagen? Okay, ich bekenne mich schuldig! Ich bekenne mich schuldig, weil ich keine perfekte Mutter bin! Ich bekenne mich schuldig, weil ich oft zu streng mit dir war. Ich bekenne mich schuldig, weil ich dir offensichtlich nicht oft genug gesagt habe, dass ich dich trotz allem liebe! Ich bekenne mich schuldig, weil ich dich nie wirklich verstanden habe! Ich bekenne mich schuldig! Schuldig! Schuldig! Schuldig!
„Mutter“